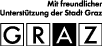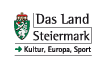„Als der Große Krieg losging, da spürte ich, dass ich nicht mehr filmen kann. Die Realität war viel stärker als der Film.“
Bei der 73. Berlinale begeisterte die ukrainische Filmemacherin Alissa Kowalenko das Publikum mit ihrem Film We will not fade away, der von Jugendlichen in den Frontgebieten handelt. In kurzer Zeit erhielt der Film mehrere Auszeichnungen. Alissa dokumentiert die russische Aggression seit deren Beginn im Jahr 2014. Während der Filmarbeiten in Donezk wurde die damals Siebenundzwanzigjährige von den Russen gefangen genommen. Sie wurde verhört und mit dem Erschießen bedroht, und kam erst auf Druck der internationalen Medien frei. Alissa filmte danach an den am heißesten umkämpften Orten weiter, und als der Krieg im Großen begann, erfüllte sie das Versprechen, das sie sich 2014 gegeben hatte, und meldete sich als gewöhnliche freiwillige Soldatin an die Front. Nach vier Monaten kehrte sie jedoch an die „Kulturfront“ zurück und stellte den Film fertig, den sie nun der Welt präsentiert.
Alissa, warum haben Sie sich nach Beginn des großen Krieges freiwillig an die Front gemeldet? Was war das für ein Versprechen, das Sie sich 2014 gegeben haben?
Das war, als ich an der Front im Donbass filmte, im Dorf Pisky und am Flughafen Donezk. Schon damals steckte ich in dem Dilemma: einfach Filme machen und die Geschehnisse beobachten oder mehr tun. Da entschied ich für mich, erst einmal Regisseurin zu bleiben, aber mir zu versprechen: Sollte sich der Krieg zu voller Intensität auswachsen, dann lege ich die Kamera beiseite und kämpfe. Diese Entscheidung war für mich damals schlüssig.
Erzählen Sie mehr von dieser Zeit. Wer war Alissa Kowalenko damals?
Alles begann mit der Revolution der Würde auf dem Maidan. Die Geschehnisse zu filmen war mir damals sehr wichtig, denn ich begriff, dass es um die Entstehung einer ukrainischen Zivilgesellschaft und um wichtige demokratische Werte ging. Mit meiner Freundin und Kollegin filmten wir Tag und Nacht. Wir übernachteten sogar auf dem Maidan. Wir waren zugleich Dokumentarfilmerinnen und Teilnehmerinnen. Vor uns vollzog sich Geschichte, und wir filmten ein Zeitdokument, ohne groß darüber nachzudenken, ob das schließlich einen Film geben würde oder einfach eine Art Archiv der Ereignisse.
Als Russland die Krim annektierte und mit den Kampfhandlungen im Donbass begann, spürte ich wieder die Wichtigkeit, das alles zu dokumentieren. Daher fuhr ich nach Donezk mit meinem Freund Stéphane – der französischer Journalist und heute mein Mann ist. Er fuhr ins besetzte Donezk, weil er an einer Reportage über gefangene Ukrainer arbeitete, und er machte noch Witze, als er sagte, dass er unter den Gefangenen hoffentlich nicht mich treffen würde. Er wollte mich gar nicht mitnehmen und ich konnte ihn nur mit Mühe überzeugen.
Sie fürchteten öffentliche Aufmerksamkeit und Schlagzeilen. Das hat mir das Leben gerettet.
Für ukrainische Journalisten war es da schon äußerst gefährlich, in Donezk zu arbeiten. Ende April 2014 wurden die wichtigsten administrativen Gebäude bereits von prorussischen Kräften kontrolliert. Nach der von Russland inszenierten Pseudo‐Volksabstimmung wurde die Volksrepublik Donezk ausgerufen, die von keinem einzigen europäischen Land anerkannt wurde.
Ukrainische Journalisten erhielten keine Dreherlaubnis. Ich fuhr trotzdem, und wenn ich in Donezk filmte, witzelten die ausländischen Journalisten: Sag ihnen, du bist von Russia Today und hast nur deinen Ausweis im Hotel vergessen. Ein paar Mal habe ich das tatsächlich gesagt, aber lang konnte das nicht gutgehen. Daher beschloss ich, auf die ukrainische Seite der Front zu fahren und die Soldaten an einem Kontrollposten bei Slowjansk zu filmen. Stéphane blieb für seine Reportage in Donezk. Der Kontrollposten, zu dem ich fuhr, war mittlerweile von russischen und prorussischen militärischen Gruppierungen eingekreist, und auf dem Weg dahin musste ich fünf Kontrollposten passieren.

Als man uns auf dem Rückweg nach Donezk anhielt, sagte der Taxifahrer, mit dem ich fuhr: Sie ist auf Seiten des ukrainischen Militärs. – Man zog mich aus dem Auto, weil man mich aus irgendeinem Grund für einen Scharfschützen hielt. Man schlug mich, um zu überprüfen, ob ich tatsächlich Scharfschütze bin, denn angeblich „weinen Scharfschützen nicht“. Aber meine Sinnesorgane waren wie abgeschaltet, ich spürte keinen Schmerz, als wäre ich betäubt. Ich begriff, dass man mich verhören würde, und überlegte, was ich erzählen sollte, wenn sie mich foltern würden.
Zum Verhör brachten sie mich in die Stadtverwaltung von Kramatorsk. Es kam ein russischer Militär, der Chef der Spionageabwehr mit Tarnnamen »Grom« (Donner), der sagte: Ich werde dich jetzt verhören. Sehr lange schwieg ich und versuchte, in meinem Kopf ein Puzzle zu einer vollständigen Geschichte zusammenzulegen. Sie begannen, damit zu drohen, dass sie sich meine Eltern und meinen Freund Stéphane holen würden; sie sagten, dass sie mir die Finger brechen, sollte ich weiterhin schweigen.
Da begann ich irgendwas zu reden und gab lauter unrichtige Positionen des ukrainischen Militärs an. Ich sagte ihnen auch eine falsche Adresse des Hotels, in dem Stéphane wohnte. Nach mehreren Stunden Verhör brachte mich der russische Offizier in eine Wohnung, wo ich mich vollständig ausziehen und in einem Badezimmer mit offener Tür waschen musste. Er gab mir ein winziges Handtuch, mit dem man sich unmöglich bedecken konnte. Und erlaubte mir auch nicht, mich wieder anzuziehen. Ich musste mich neben ihn setzen, und er erklärte, dass ich mit ihm reden müsse, er einsam sei und gekommen, um „das Brudervolk zu verteidigen“. Er fragte, warum ich ihn hasse, zerlegte vor mir seine Waffe und versuchte, mich zu vergewaltigen.
Da aber die ausländischen Journalisten wussten, dass ich gefangen war, und etwas für meine Freilassung unternahmen, ließ man mich leben. Sie fürchteten öffentliche Aufmerksamkeit und Schlagzeilen. Das hat mir das Leben gerettet. Nach vier Tagen hat man mich freigelassen.
Wurden Sie tatsächlich mit dem Tod bedroht?
Gefoltert wurde ich bei dem Verhör nicht und geschlagen nur bei der Verhaftung auf dem Kontrollposten, aber sie versuchten es mit psychischem Druck. Immer wieder hieß es, ich falle unter einen Erschießungsparagraphen, dass sie mich also erschießen würden müssen. Sie spielten mit mir das Spiel vom good and bad cop, drohten, mir die Ohren oder die Finger abzuschneiden. Sie versuchten, mir Spionage für die ukrainische Armee anzuhängen. Es war absurd. Sie wollten mir irgendein Papier unterschieben, aber die Handschrift darauf war nicht von mir.
Zwei Tage wurde ich unter Beobachtung in der Stadtverwaltung festgehalten, und zwei Tage in der Wohnung. Ich wurde verrückt, denn es war wie in einer Einzelzelle. Ich wusste nicht, wie es meinen Angehörigen ging. Und nur mit den eigenen Gedanken allein war es sehr schwer. Dank der Unterstützung der journalistischen Community ließ man mich nach vier Tagen frei. ‚Grom‘ sagte, dass es sein Verdienst wäre, wenn man mich nicht erschossen habe.
Hatte diese Gefangenschaft Folgen für Sie? Ich meine nicht nur gesundheitlich, sondern hinsichtlich Ihrer filmischen Pläne?
Die traumatischsten Details meiner Gefangenschaft habe ich fast niemandem erzählt. Ich habe das sehr tief verdrängt und mich damit gerettet, dass ich viel arbeitete. Ich fuhr in die Kampfgebiete – in das Dorf Pisky im Gebiet Donezk und zum Flughafen Donezk, wo die unerbittlichsten Gefechte stattfanden. Nach dem, was geschehen war, ist bei mir ein Teil der reflexartigen Angst abgestorben. Nach einer solchen Erfahrung empfindet man nichts mehr so schnell als schlimm … Und in gewisser Weise hat mir das auch Kraft gegeben.
Als ich Stéphane sagte, dass ich mich für den Krieg melde, hielt er sich gerade in Paris auf. Erst war er schockiert, dass ich in den Krieg ziehe, dann, dass ich es mit den Freiwilligen des Rechten Sektors mache. Er hatte Angst, dass ich gemeinsam mit ihnen wieder in Gefangenschaft komme, und dann würde man mich ganz sicher erschießen. Im Gegensatz zu den „blutrünstigen Nazis“, mit denen die russische Propaganda der Welt Angst einjagen möchte, waren das aber ganz gewöhnliche Burschen – Lehrer, Ärzte, Baumeister, Unternehmer, die sich freiwillig zur Verteidigung ihres Landes gemeldet hatten. Viele von ihnen verheimlichten sogar vor ihren Liebsten, dass sie an der Front kämpften, um ihnen keinen Kummer zu machen. Sehr rasch wurden sie zu meiner zweiten Familie.
Die Hauptpositionen der Freiwilligen waren beim Ort Pisky, der auch stark beschossen wurde. Es gab fast kein einziges unbeschädigtes Gebäude mehr. Jeden Tag nahm man uns unter Beschuss, mit verschiedenen Waffentypen, darunter Grad‐Raketenwerfern. Und als wir dann zum alten Terminal am Flughafen Donezk kamen, sagte man mir, dass ich die erste Frau war, die es bis dahin geschafft hatte. Man musste dazu um drei Uhr nachts im Gänsemarsch und tief gebückt einen gefährlichen Abschnitt überwinden, und das war kompliziert, weil die Positionen der prorussischen Gruppierungen und russischen Kräfte ganz in der Nähe waren.
Zu der Zeit war der Flughafen in Donezk so etwas wie eine „Festung der Unbeugsamkeit“, und die Freiwilligen, die dort positioniert waren, begann man als Cyborgs zu bezeichnen. Das Metall hielt nicht stand, aber die Menschen ganze 242 Tage, bis die russischen Kräfte den Flughafen vollständig einnehmen konnten.
Als ich an die Front kam, wollte ich unbedingt einen Dokumentarfilm über diese ganz normalen Burschen drehen, die bis zum Krieg eine gute Arbeit hatten, Familie und ein komfortables Leben, und die sich bewusst dafür entschieden hatten, die Heimat zu verteidigen. Allein die Gesichter dieser Männer haben Eindruck auf mich gemacht. Viele hatten überhaupt keine militärische Erfahrung. Mir war es wichtig, gerade über sie einen Film zu machen. Ich meine, wenn wir die Grenzen halten konnten, dann vorwiegend dank dieser Freiwilligenverbände, denn in der regulären Armee war die Lage damals nicht die beste.
Es war das für mich eine ganz andere Welt. Richtiger Krieg. Du weißt nicht, wann deine Stunde schlägt. Einmal trank ich gerade Kaffee und telefonierte mit meiner Mutter, als der Beschuss losging. Sofort lief ich Richtung Keller. Ich war gerade erst weg, eine Minute war erst vergangen, und dort, wo ich gestanden war, schlug eine Granate ein. Und dann gewöhnst du dich, sowas schreckt dich nicht mehr. Dann schreckt dich nur, dass dich das nicht mehr schreckt …
Ich befand mich in einem ständigen Dilemma: weiterhin Filme machen, oder mich als Freiwillige melden? Ich wollte kämpfen, aber Stéphane wollte natürlich nichts davon hören. Er machte sich große Sorgen und sagte, der Krieg würde auch unsere Beziehung umbringen. Alles ganz und gar nicht einfach. So blieb ich damals Filmemacherin, aber die aufgenommenen Szenen kamen dann in den Dokumentarfilm Alisa in Warland.
Was war für Sie die schwerste Kriegserfahrung?
Die schlimmste Geschichte für mich war im Himmel. Das war unser Bohrturm, der „Himmel“ hieß, ein alter Bohrturm, zehn Stockwerke hoch, von dessen Spitze aus die Zielgenauigkeit unserer Artillerie optimiert werden konnte. Unser Turm wurde ständig beschossen.
Es war Winter und ich ging mit Freiwilligen zum Filmen. Es war Abend, wir gingen durch den Schnee, und es war schwierig, dieses Bauwerk zu besteigen, weil es ziemlich beschädigt war. Außerdem waren Scharfschützen im Einsatz, sodass wir über die offene Treppe sehr rasch laufen mussten. Oft sagten die Separatisten über Funk zu uns: Was, ihr friert im Himmel? Na, dann heizen wir euch mit dem Raketenwerfer richtig ein.
Und dann gewöhnst du dich, sowas schreckt dich nicht mehr. Dann schreckt dich nur, dass dich das nicht mehr schreckt …
Das war ein schreckliches Gefühl … Es ist eine Sache, wenn du auf dem Boden beschossen wirst, aber eine andere, wenn das auf Höhe des zehnten Stocks passiert. Von den Granattreffern und den Vibrationen schwankt das Bauwerk hin und her, und du glaubst, du stirbst, weil das Ganze jeden Moment in sich zusammenfällt. Für mich war das die schlimmste Erfahrung, wo ich den Tod sehr nahe gefühlt habe.
Was war für Sie als Filmemacherin besonders wichtig, in diesem Krieg zu dokumentieren?
Für Dokumentarfilmer ist es im Krieg das Wichtigste, zu vergessen, dass du den Krieg filmst. In Wirklichkeit sind die Geschichten jenseits des Kriegs wichtig. Subjekt ist nicht der Krieg, sondern das, was jenseits davon ist: die Menschen und ihre Geschichten, das ist am wichtigsten. Mir ging es darum zu zeigen, wie wertvoll es ist, sogar unter Kriegsbedingungen Menschlichkeit, Freundschaft und humane Werte zu bewahren. Und auch den Humor. Das ist es, was das Gehirn vor dem Wahnsinn rettet und beim Überleben hilft. Diese Burschen machen ohne jegliches Pathos einfach ihre Arbeit. Im Krieg geht es nicht immer um Heldentum. Die Realität ist viel prosaischer. Sie ist schwere Routinearbeit, und es ist wichtig, dass sie getan wird. Das war mir wichtig zu filmen.

Sie haben viel in den Regionen Donezk und Luhansk gedreht. Wie war da die Stimmung der einfachen Leute: Haben die wirklich auf Russland gewartet, oder ist das russische Propaganda? Wie hat sich die Stimmung im Laufe des Kriegs verändert?
Der Mittelstand, die Kleinunternehmer, die das Leben in Europa gesehen haben, die gereist sind und nicht in Isolation gelebt haben, die hatten ganz überwiegend eine aktive proukrainische und proeuropäische Haltung und waren sich der Bedeutung demokratischer Werte bewusst. Die Altersklasse fünfzig plus folgte aber mehrheitlich dem russischen Narrativ. Dabei warteten sie nicht so sehr auf die „Russische Welt“ oder auf Russland, als auf eine Rückkehr der Sowjetunion, wo sie schön und jung waren, wo die Entscheidungen von anderen getroffen wurden und sie nichts selbst tun mussten. Die junge Generation ist da ganz anders. Wir haben Jugendliche im Donbass gefilmt, und die sind tatsächlich die Zukunft der Region. Und die waren nicht für Russland. Sie konnten die ukrainische Regierung kritisieren, aber das russische Narrativ zählte für sie nicht mehr.
Es gab auch eine Kategorie von Menschen im Donbass, die sich von der Ukraine verraten fühlten, weil niemand mit ihnen einen Dialog geführt hat. Zudem gab es in vielen Städten und Dörfern im Donbass kein ukrainisches Fernsehen. Stellen Sie sich das vor! Während der acht Jahre Krieg sahen die Menschen russische Sender und bekamen ihre tägliche Propagandadosis, lebten also in diesem medialen Umfeld. Und das war der Fehler der ukrainischen Regierung: nichts zu unternehmen gegen die Absenz ukrainischer Fernsehsender. Die Situation konnte sich allerdings von Ort zu Ort unterscheiden, je nach Nähe zum russischen Territorium und je nachdem, wie isoliert der Ort war. Daher sind Generalisierungen schwierig.

Hat Sie der russische Großangriff bei der Filmarbeit überrascht?
Einen Monat vor Beginn der Großinvasion sind wir mit der ersten Version des Rohschnitts von We will not fade away über Jugendliche im Donbass fertig geworden. Ich war mit dem Nachtzug von Kyiw in die Region Donezk unterwegs, als mich um fünf Uhr morgens Mama anrief und weinend sagte: Jetzt ist es so weit, es geht los … Sie war da in Kyiw, mit meinem und Stéphanes Sohn Théo. Sie hörten die Explosionen in der Stadt und fuhren noch in den ersten Kriegstagen in die Westukraine, wo es sicherer war.
Dann bekam ich Anrufe von den Eltern der Jugendlichen aus meinem Film. Wir weinten zusammen, weil wir verstanden, dass die Lage ernst war. Dann versuchte ich, für mich herauszufinden, was ich jetzt tun sollte. Ich spürte, dass ich nicht mehr filmen konnte und auch nicht mehr wollte. Die Realität war viel stärker als der Film. Ich verstand, dass es kein Moment für den Film war, dass man jetzt handeln musste. Ich wollte unseren Filmhelden helfen und versuchte ihre Familien zu überreden, das Dorf Zolote, das sehr nah an der Front lag, zu verlassen. Leider lehnten sie ab. Es gab viele Menschen im Donbass, die die acht Jahre Krieg überstanden hatten und jetzt die Gefahr nicht spürten.
Unter Tränen musste ich mir eingestehen, dass ich nichts mehr machen konnte. Etwas später gelang es mir, eine der Heldinnen meines Films, das Mädchen Lisa, die damals in Charkiw studierte, in Sicherheit zu bringen. Wir holten sie aus einem Luftschutzkeller und brachten sie an die Grenze zu Polen.
Danach beschloss ich, mein Versprechen zu erfüllen und Soldatin zu werden. Mir schien, es sei der einzige Weg, einen Beitrag zur Verteidigung des Landes zu leisten. Ich verabschiedete mich von meiner Mutter und meinem Sohn und schloss mich einem Bataillon der ukrainischen Freiwilligenarmee an. Ihren Kommandanten mit Decknamen „Bars“ (Leopard) kannte ich schon seit 2014 sehr gut als einen besonders guten Kämpfer.
Soweit ich weiß, waren Sie in einer Sturmkompanie, wo die Bedingungen selbst für Männer sehr schwierig sind. Wie haben Sie es geschafft, damit zurechtzukommen?
Im Grunde erfüllten wir die Funktion der Infanterie. Erst kämpften wir mit der 72. Brigade, zuerst in der Oblast Kyiw, dann Charkiw. Unsere Einheit war an Angriffsoperationen beteiligt und an der Befreiung ukrainischer Territorien.
Wir hatten weibliche Sanitäter, aber im Laufe der Monate haben sich viele anderenn Einheiten der ukrainischen Streitkräfte angeschlossen, denn als Freiwillige hatten wir keinen offiziellen Status, keine medizinische Absicherung und nicht einmal ein Gehalt. In der Kompanie blieben nur die Standhaftesten und Verrücktesten (lacht). Wir hielten Positionen in der Oblast Charkiw nahe der russischen Grenze. Es war eine schwierige Aufgabe, aber man gewöhnt sich.

Hatten Sie bei der Entscheidung, an die Front zu gehen, die Unterstützung Ihrer Familie?
Seit ich in Gefangenschaft war, machte sich Mama große Sorgen, obwohl die Familie schon verstand, wie wichtig das war, was ich tat. Und Stéphane wusste von dem Versprechen, dass ich mir 2014 gegeben hatte. Als die Großinvasion begann, erinnerte ich ihn daran. Er war nicht dafür, aber er akzeptierte meine Entscheidung. Er war sehr unruhig, denn er wusste, dass ich nach der Gefangenschaft in den besetzten Gebieten auf einer schwarzen Liste stand und im Fall einer nochmaligen Gefangenschaft keine Chance hatte, da wieder rauszukommen. Mama und unser Sohn wurden nach einiger Zeit nach Frankreich evakuiert.
Während der Kampfhandlungen kamen Sie in sehr schwierige Situationen, wo Menschen ihr Leben ließen. Waren Sie moralisch überhaupt vorbereitet auf richtigen Krieg?
Wir waren sehr nahe zur russischen Grenze. Es sollten einige ukrainische Kleinstädte und Dörfer befreit werden. Die Operation wurde mehrmals verschoben. Die Lage an der Front verschlechterte sich und unsere Operation scheiterte. Von Anfang an lief es nicht wie geplant.
Als wir zum Angriff übergingen, wurden wir von allen Seiten unter Beschuss genommen. Wie in einem Hollywood‐Blockbuster. Rundherum ging alles in die Luft, rechts, links, überall dichter Rauch. Hätte eine Explosion ein paar Meter näher stattgefunden, ich wäre nicht mehr da. Es ist ein Wunder, dass wir das überlebt haben. Die zentralen Kräfte und die linke Flanke wurden zerschlagen, sehr viele kamen ums Leben.
Wir waren die rechte Flanke, und wir bekamen den Befehl zum Rückzug. Wir gingen im Abstand von zwei Metern einer hinter dem anderen über ein vermintes Feld. Es war schwierig, sich mit der ganzen Ausrüstung fortzubewegen. Wir brachen um vier Uhr in der Früh auf und machten erst spät in der Nacht Halt.
Ich fühlte mich zwiegespalten. Als wäre ich nicht mehr die Filmemacherin von früher. Der Krieg ändert das Koordinatensystem so sehr, dass man die Welt ganz anders sieht.
Dann setzten wir uns irgendwo im Grünen fest und kontrollierten eine Straße. Als aber die russische Armee zum Angriff überging, verschlechterte sich die Lage weiter. Das letzte Monat meines Dienstes war sehr schwierig, wir standen nonstop unter Beschuss.
Sind Sie deswegen zu Ihrem eigentlichen Beruf zurückgekehrt?
Nein. Vielmehr hat unsere Einheit zu existieren aufgehört. Eines Tages waren wir bei Übungen, um das Steuern von Drohnen zu lernen. Und als wir zurückkamen, sahen wir, dass unsere Basis zerbombt war. Eigentlich hätten wir schon an dem Tag zurückkommen sollen, an dem die Rakete einschlug, aber im letzten Moment wurden die Pläne geändert und wir kamen etwas später zurück. Unser Kamerad, der geblieben war, ist ums Leben gekommen. Stundenlang haben die Retter seine Leiche aus den Ruinen geborgen.
Das ganze medizinische Equipment war verbrannt und wir waren in einem schrecklichen Zustand. Da sagte unser Kommandant: Es ist genug. Das Ende unserer Einheit in der Freiwilligenarmee ist gekommen. Weiterkämpfen müssen wir im Rahmen der regulären ukrainischen Armee. – Ich hätte auch einen Vertrag unterschreiben können, aber Stéphane, mein Mann, sagte: Du kannst natürlich einen Vertrag unterschreiben, aber deinen Fronteinsatz hast du ja schon gehabt. Gut nur, dass du nicht gestorben bist. Jetzt ist es Zeit, etwas an der kulturellen Front zu tun. Es wäre falsch, wenn du den Film nicht fertig machst, an dem du drei Jahre lang gearbeitet hast. Das wäre falsch, auch deinen Protagonisten gegenüber.
Ja, mir war klar, dass es wichtig war, den Film abzuschließen und die Geschichte der Jugendlichen fertig zu erzählen, und deshalb bin ich in das gewohnte Leben zurückgekehrt. Ich fühlte mich aber gleichzeitig denen gegenüber, die geblieben waren, schuldig und wollte auch zurück. Ich fühlte mich zwiegespalten. Als wäre ich nicht mehr die Filmemacherin von früher. Der Krieg ändert das Koordinatensystem so sehr, dass man die Welt ganz anders sieht.
Was genau hat sich geändert, als Sie aus dem Krieg zurückgekommen sind?]
Das Interview kann in voller Länge in Olha Volynskas Interviewband »Wie der Krieg uns verändert« nachgelesen werden. Das Interview wurde aus dem Ukrainischen übersetzt von Harald Fleischmann.

Olha Volynska
Olha Volynska ist eine Journalistin, Schriftstellerin, Dokumentarfilmerin und Menschenrechtsaktivistin aus Dnipro in der Ukraine.